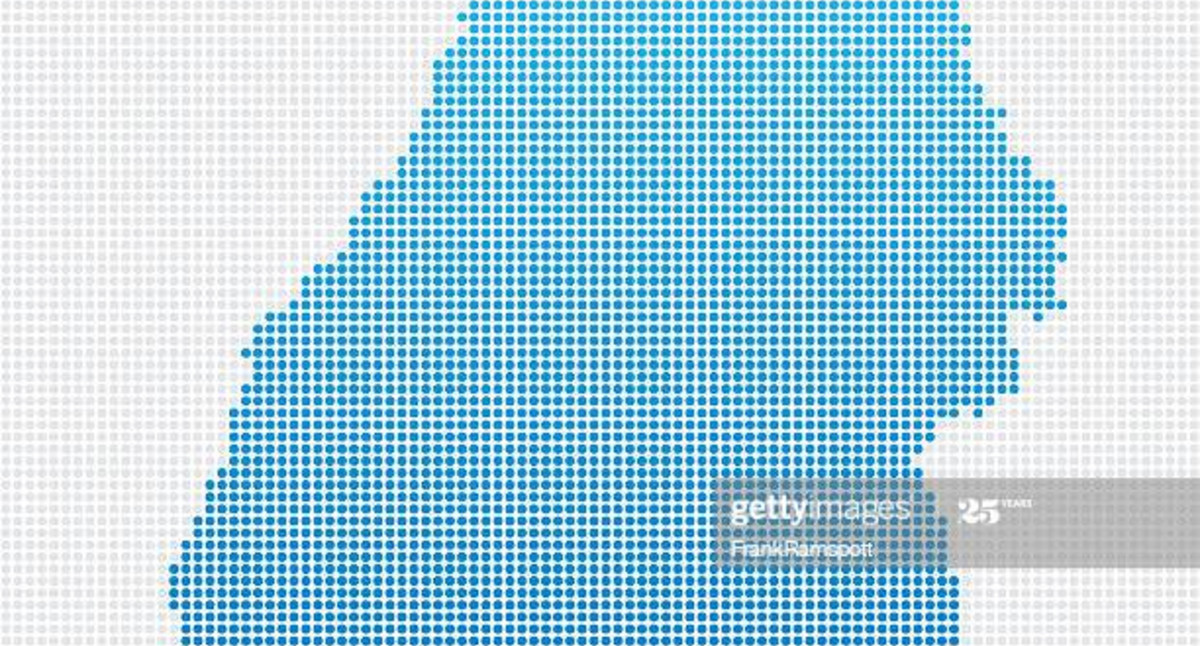Wasserstoffmotor
Der Verzicht auf fossile Energieträger in Energiewirtschaft und Mobilität wird von Gesellschaft und Politik gleichermaßen eingefordert. Neben der Elektromobilität und synthetischen Kohlenwasserstoffen verbleibt Wasserstoff als zielführende Technologielösung, vor allem für den Nutzfahrzeugsektor. Dabei hat der Wasserstoffmotor das Potenzial, zeitnah verfügbar eine attraktive Lösung darzustellen. Probleme der Brennstoffzellentechnologie – wie Kosten, Thermomanagement und Dauerhaltbarkeit – spielen beim Wasserstoffmotor eine untergeordnete Rolle. Herausforderungen sind hingegen vor allem die politische und gesellschaftliche Akzeptanz, geringste Restemissionen, die Tanksystemwechselwirkung mit der Gemischaufbereitung sowie eine weitere Wirkungsgradsteigerung. Die Forscherinnen und Forscher des KIT beschäftigen sich vor allem mit den Herausforderungen der Wasserstoffbasierten Energieumsetzung aber auch den wichtigen Wechselwirkungen des Wasserstoffs mit den Materialien. Insgesamt ist der Wasserstoffmotor eine ergänzende Technologie, die bei Nutzung der gleichen Wasserstoffinfrastruktur vor allem für schwere und hochausgelastete Fahrzeuge attraktiv ist.
Modulare und skalierbare Produktion von Brennstoffzellensystemen (Fotos im Anhang)
Brennstoffzellensysteme sind hochkomplexe Einheiten und werden bisher aufwendig manuell montiert. Das wbk Institut für Produktionstechnik untersuchte im Projekt „INLINE“, wie der Übergang von der manuellen Montage hin zu automatisierten Prozessen gestaltet werden kann. Es wurde eine Produktionslinie entworfen, die dazu in der Lage war flexibel auf schwankende Stückzahlen zu reagieren. Durch Simulationsmodelle konnte die entworfene Produktionslinie hinsichtlich verschiedener Produktionsszenarien analysiert und bewertet werden. Die entwickelte Inline-Messtechnik ermöglichte die Datenerfassung während der Montageprozesse, die zur Prozesssteuerung und Qualitätssicherung beitragen. Die EU hat das Vorhaben mit 3,2 Millionen Euro im Programm „Horizon 2020“ gefördert. Die flexible und skalierbare Stackproduktion selbst wird am wbk im Projekt EMSigBZ (gefördert durch BMVi) sowie im Projekt KliMEA (gefördert durch das Wirtschaftsministerium BW) betrachtet.
Weiterführender Link zum Projekt Inline: https://www.inline-project.eu/
Refuels: Regenerative Kraftstoffe für das Klima - Baustein einer CO2-neutralen Mobilität (Foto im Anhang)
Der Einsatz regenerativ hergestellter Kraftstoffe leistet neben anderen Maßnahmen, wie dem Ausbau der Elektromobilität, einen vielversprechenden Beitrag zu einer CO2-neutralen Mobilität. Denn gerade der Schiffs-, Luft-, Bahn- und Lkw-Verkehr, bei dem lange Strecken zurückgelegt oder große Lasten transportiert werden, benötigt auch zukünftig flüssige Kraftstoffe. Regenerative Kraftstoffe lassen sich aus kohlenstoffhaltigen Reststoffen der Land- und Forstwirtschaft sowie durch die direkte Synthese aus CO2 und Elektrolyse-Wasserstoff mit Nutzung elektrischer Energie aus regenerativen Quellen herstellen. In der Forschungsinitiative „reFuels – Kraftstoffe neu denken“ befassen sich verschiedene Institute des KIT gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg und zahlreichen Partnern aus der Automobil-, Automobilzuliefer- und Mineralölindustrie mit der effizienten Herstellung und Nutzung von regenerativen Kraftstoffen. Ziel ist, dass alle Fahrzeuge – inklusive der Bestandsflotte – regenerative Kraftstoffe tanken können, um eine schnelle ergänzende Lösung für eine CO2-neutrale Mobilität zu schaffen.
Weiterführender Link zum Projekt reFuels: www.refuels.de
Material und Wasserstoff
Im Fokus dieser Forschung am KIT steht die Materialforschung für Wasserstoffanwendungen, also etwa zu Stählen, bei denen im Kontakt mit Wasserstoff keine Materialschäden auftreten sollten (Effekte der Wasserstoffversprödung) oder zu nanostrukturierten Materialien, die defekt- und spannungsbasierte Effekte aufweisen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der Wasserstoffspeicherung. Dabei stellt die die Festkörperspeicherung im Hinblick auf Sicherheit und Speicherdichte die attraktivste Form der Speicherung dar.
P2X / Energy Lab 2.0
Im Energy Lab 2.0 erproben Forscherinnen und Forscher des KIT verschiedene Elektrolyseverfahren zur Erzeugung von Wasserstoff oder Synthesegas im Zusammenspiel mit den nachfolgenden Umwandlungsschritten zu synthetischen CO2-basierten chemischen Energieträgern in einem containerbasierten Power-to-X-Anlagenverbund (siehe Bild).
Dabei stehen neben einem hohen Gesamtwirkungsgrad vom Strom zum chemischen Energieträger, der durch Wärmeintegration zwischen den einzelnen Prozessschritten erreicht werden kann, vor allem modulare Anlagenkonzepte mit neuen kompakten Reaktortechnologien im Mittelpunkt, die einen lastflexiblen Betrieb dezentraler Anlagen, gespeist durch erneuerbare Energie ermöglichen. Zielprodukte sind unter anderem Kerosin für einen zukünftigen CO2-neutralen Luftverkehr und Methan zur saisonalen Speicherung großer Energiemengen und zur Sektorenkopplung von Strom und Wärme.
Weitere Informationen zu Power-to-Liquid
HySafe-BW
Nach dem Vorbild des europäischen Wasserstoff-Sicherheitspanels (European Hydrogen Safety Panel, EHSP) soll ein Sicherheits- und Beratungsgremien auf Landesebene entstehen, das der Vernetzung dient, darüber hinaus aber insbesondere der Einhaltung des Stands der Technik und höchster Sicherheitsstandards.
Weitere Informationen: https://hysafe.info/
Systemvertrauen
Auch wenn eine neue Technologie „auf dem Papier“ längst sicher ist, spielt deren Wahrnehmung in der Gesellschaft eine wesentliche Rolle dafür, ob sie sich durchsetzen kann. Die Forscherinnen und Forscher wollen deshalb beispielsweise in einem Reallabor oder einer Modellregion genau untersuchen, wie Wahrnehmung und Akzeptanz funktionieren – und wie sich auf dieser Basies im nächsten Schritt Vertrauen in eine neue Technologie ausbauen lässt.
Brennstoffzellenfahrzeug Mercedes GLC F-Cell
Sowohl für lehrintegrierte Forschung, z.B. für Studienarbeiten, Messfahrten und Nachhaltigkeitsstudien, als auch für Dienstfahrten steht der DHBW Stuttgart ein Brennstoffzellenfahrzeug Mercedes GLC F-Cell zur Verfügung. Dessen Einsatz wird maßgeblich durch das Zentrum für Fahrzeugentwicklung und nachhaltige Mobilität (ZFM) unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Harald Mandel betreut. Das Fahrzeug trägt somit zur nachhaltigen Mobilität an der DHBW Stuttgart und zum Wissens- und Technologietransfer an zukünftige Ingenieur*innen bei.
Forschungsarbeiten Methanol-Brennstoffzelle
Der MORRIS MOKE der DHBW ist die Neuauflage eines klassischen Strandwagens der 1970er Jahre. Er wurde mit Unterstützung der DHBW als reines Elektrofahrzeug entwickelt und wird in Frankreich produziert. Auf dieser Basis entstand der MOKE VISION FuelCell als Konzeptfahrzeug mit einer Hochtemperatur-Methanol-Brennstoffzelle. Methanol als Wasserstoffträger kann regenerativ erzeugt werden, ist ein sehr sicherer Kraftstoff und könnte einfach über die bestehende Tankstellen-Infrastruktur verteilt werden.
Assoziation im Verbund H2Rivers - Speicherung und angrenzende Technologien
Die Metropolregion Rhein-Neckar wird Modellregion für die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und setzt bei ihren Maßnahmen auf das Wissen aus jahrelanger Forschung an der DHBW Mannheim. Als asoziierte Partnerin ist die DHBW Mannheim im Konsortium „H2Rivers“ vertreten und bringt ihre Expertise zur Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in das 20-Millionen-Euro-Projekt ein.
Weitere relevante Forschungsaktivitäten, z.B. ein PEM Brennstoffzellen-Prüfstand sowie PEM elektrochemischer Verdichter
Auf dem Weg zum Wasserstoffzentrum:
Durch den Ausbau zum Anwendungs- und Bildungszentrum Wasserstoff treibt die DHBW Mannheim Bildung, Forschung und Anwendung rund um grünen Wasserstoff voran. Bei einem Besuch am Eppelheimer Campus Ende August konnte sich der Innovationsbeauftragte der Bundesregierung, Dr. Stefan Kaufmann, von dem Mehrwert für die Industrie und die gesamte Rhein-Neckar-Region überzeugen.
Wasserstoff als Energieträger der Zukunft:
Wasserstoff als Schlüssel der Energiewende? Im Rahmen der Online-Fachtagung "DHBW forscht: Wasserstoff - Energieträger der Zukunft?", die in Zusammenarbeit mit der IHK Rhein-Neckar und der DHBW Mannheim realisiert wurde, wurden Einsatzmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit und Marktpotenzial von Wasserstoff als Energieträger beleuchtet. Ein virtueller Rundgang durch das Wasserstoff- und Brennstoffzellenlabor am Eppelheimer DHBW-Campus, an dem mit Industriepartnern an der Optimierung von Brennstoffzellen zur Gewinnung von Strom aus Wasserstoff geforscht wird, rundete die Fachtagung mit über 145 Teilnehmer*innen ab.
Energieumwandlung und -speicherung: Die Rolle von reversiblen Power-to-Gas Anlagen
Der großvolumige Ausbau von erneuerbaren Energien, wie Wind- und Solaranlagen, hat in vielen Regionen der Welt dazu geführt, dass die Verfügbarkeit von Strom volatiler geworden ist. Um die Stromversorgung auch zukünftig zu gewährleisten, werden Energiespeicher eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Gleichzeitig zeigt es sich, dass Wasserstoff ein großes Potential als sauberer Energieträger für die Dekarbonisierung der Industrie hat. Reversible Power-to-Gas Anlagen könnten zu Zeiten von ausreichend und damit günstigem Strom Wasserstoff für die Industrie herstellen und zu Zeiten von Stromknappheit rückwärts operieren, um aus Wasserstoff wieder Strom zu produzieren. Während reversible Power-to-Gas Anlagen bisher zu teuer waren, deuten jüngste Entwicklungen in den Kosten und der Energieeffizienz solcher Anlagen darauf hin, dass sich dieses Fazit sich bald ändern wird. Dr. Gunther Glenk und Prof. Stefan Reichelstein vom Mannheim Institute for Sustainable Energy Studies (MISES) untersuchen diese Entwicklungen in einem kürzlich erschienen Arbeitspapier. Link zur Studie
Energiewende im Transport: Wasserstoffbusse in der Metropolregion Rhein-Neckar
Sollen Treibhausgase umfassend reduziert werden, müssen sich auch Transportdienstleistungen von fossilen Brennstoffen als Energieträger abwenden. Der Nahverkehrsbetreiber der Metropolregion Rhein-Neckar, RNV, hat sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Busflotte auf emissionsfreie Busse umzustellen. Dabei sollen insbesondere neuartige Busse zum Einsatz kommen, die eine Batterie und eine Brennstoffzelle mit Wasserstofftank besitzen. Die Kombination dieser beiden Technologien ermöglicht längere Reichweiten, was sich täglichen Betriebsverlauf vor allem auf anspruchsvolleren Routen ökonomisch rentieren könnte. Das Mannheim Institute for Sustainable Energy Studies (MISES) der Universität Mannheim plant zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) die Umstellung der Busflotte der RNV wissenschaftlich zu begleiten. Während das KIT sich auf die technische Ausgestaltung dieser Umstellung fokussieren wird, wird das MISES die ökonomische Effizienz der Umstellung auf Basis von Lebenszykluskosten untersuchen. Ziel dieses Projekts ist neben der akademischen Auswertung der Umstellung Erkenntnisse und Empfehlungen für andere Nahverkehrsbetreiber zu generieren, wie diese möglichst schnell und kosteneffizient ihre Flotte dekarbonisieren können.
SafeDDT: Sicherheit von explosionsgefährdeten Anlagen
Das Ziel von SafeDDT ist die explosionsfeste Auslegung von Rohren und Behälter zur sicheren Handhabung von explosiven Gasgemischen, insbesondere von Wasserstoff in Luft. Ausgehend von einer speziell angepassten Fluid-Simulation, validiert durch ein Experiment (1), wird der Verlauf des Drucks über Zeit und Ort der Gasexplosion bestimmt (2). Beschrieben wird dieses mathematisch über eine Funktion p=f(x,t) (3), mit der dann mittels Finite-Elemente-Simulation mögliche mechanische Schädigungen in Rohrleitung oder Behälter bewertet werden können und eine entsprechende sichere Auslegung vorgenommen werden kann (4).
Anwendungen:
- H2 Versorgung, Erneuerbare Energie
- Kälteanlagen brennbarer Kältemittel
- Chemieanlagen
- Öl- und Gasindustrie
Projekt HydroGen
Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Industrie und Forschung wird ein wasserstofftaugliches Blockheizkraftwerk auf Basis eines modernen Erdgasmotors entwickelt. Im besonderen Fokus steht hierbei der Betrieb mit flexibler Gaszusammensetzung, von reinem Erdgas bis reinem Wasserstoff, so dass ohne Wechsel des Blockheizkraftwerkes die schrittweise Umtellung von Erdgasbetrieb zum CO2-freien Wasserstoffbetrieb stattfinden kann. Die Entwicklung erfolgt mit der Methode des digitalen Zwillings, bei der detaillierte Motorsimulationen die experimentellen Untersuchungen unterstützen.
Förderer: BMBF
Partner: Hochschule Amberg-Weiden, Fa. Senertec Kraft-Wärme-Energiesysteme, Fa. Multitorch GmbH, Stadtwerk Haßfurt GmbH
Projekt ReKra
Fahrzeugantriebe, die mit regenerativen und wasserstoffbasierten Kraftstoffen betrieben werden, stellen neben der batterieelektrischen Mobilität einen weiteren Baustein zukünftiger CO2-armer oder CO2-freier Mobilität dar. Die angestrebte Erhöhung des Wirkungsgrads bei gleichzeitig immer strenger werdenden Emissionsvorschriften bedingt eine stetige Weiterentwicklung der eingesetzten motorischen Brennverfahren. Im Rahmen des Projekts „ReKra“ werden innovative Vorkammerzündsysteme entwickelt, die eine effiziente und emissionsarme Verbrennung beim Betrieb mit erneuerbaren Kraftstoffen sogenannten eFuels ermöglichen.
Förderer: Wirtschaftsministerium BW
Partner: Fraunhofer ICT (Arbeitsgruppe NAS), Fraunhofer IWM
Projekt EGRreact
Ziel des Vorhabens EGRreact ist die Entwicklung eines sauberen und effizienten motorischen Brennverfahrens für Gasmotoren z.B. als Antrieb für Blockheizkraftwerke. Durch eine spezielle Abgasrückführstrategie wird im Motor selbst Wasserstoff erzeugt, so dass eine vergleichsweise kalte und trotzdem schnelle Verbrennung erzielt wird. Die Bildung der reaktiven Gase, insbesondere Wasserstoff und Kohlenmonoxid, erfolgt durch die partielle Erdgas-Oxidation in einem sogenannten Spenderzylinder.
Förderer: BMBF
Partner: Fa. WJ POWER GmbH
Projekt LeanStoicH2
Im Projekt LeanStoicH2 wird ein Vierzylinder-Gasmotor derart umgerüstet, dass ein Zylinder mit bis zu 100 % Wasserstoff betrieben werden kann. Das aus der Wasserstoffverbrennung resultierende Abgas eignet sich nach Trocknung mittels Brennwerttechnik aufgrund thermodynamisch vorteilhafter Zusammensetzung in idealer Weise zur Abgasrückführung für die restlichen Zylinder. Mit diesem Brennverfahren kombiniert der Gasmotor die Vorteile des Magerbetriebs (optimaler Wirkungsgrad) mit denen des stöchiometrischen Betriebs (Dreiwegekatalysator).
Förderer: BMBF
Partner: Fa. WJ POWER GmbH, Fa. IAVF Antriebstechnik GmbH, Weissgerber Engineering GmbH
Projekt Erdgas-Wasserstoff-Verdichter-Speicher-Einheit
Die Hochschule Karlsruhe realisiert eine Erdgas-Wasserstoff-Verdichter-Speicher-Einheit, um Antriebe mit hoher Leistung und moderner Gemischbildung mit Wasserstoff erforschen zu können.
Die Einheit setzt sich aus Verdichtern für Erdgas und Wasserstoff zusammen und ermöglicht Drücke bis 300 bar. Die Anlage wird mit Erdgas aus dem öffentlichen Gasnetz und mit Wasserstoff aus dem laboreigenen Elektrolyseur gespeist.
Durch die Anlage kann ein Gemisch aus Erdgas und Wasserstoff in beliebiger Zusammensetzung verdichtet und gespeichert werden und steht dann mit einstellbarem Druck an den Prüfständen zur Verfügung.
Förderer: MWK BW (Geräteprogramm)
H2-Innovationslabor
Mit Wasserstoff Klimaziele erreichen: Im H2-Innovationslabor in Heilbronn untersuchen die TU München, die Hochschule Heilbronn, das Ferdinand-Steinbeis-Institut und das Team KODIS des Fraunhofer IAO die Potenziale der Wasserstoffwirtschaft in der Region Heilbronn-Franken. Um die signifikanten Wertschöpfungspotenziale am Standort Deutschland zu halten oder auszubauen, müssen Wasserstofftechnologien intensiver erforscht und genutzt werden. Ziel des Projekts ist es, eine Pilotregion aufzubauen, welche unter anderem durch die Bundesregierung im Zuge einer nationalen Wasserstoffstrategie für die Entwicklung von Wasserstoffkonzepten gefördert wird.
H2-SO
Als Partner des vom Fraunhofer ISE koordinierten Projekts H2-SO ist die Hochschule Offenburg an der Erhebung der Wasserstoff-Potenziale für das Gebiet Südlicher Oberrhein beteiligt. Im Rahmen von BWPLUS, Transformation des Energiesystems in Baden-Württemberg – Trafo BW, sollen in einem Multiakteur-Reallabor die Perspektiven einer regionalen Wasserstoffwirtschaft ermittelt und eine Wasserstoff-Roadmap aufgestellt werden.
H2-Bus
Das Projekt „H2-Bus Offenburg“ beschäftigt sich mit der Umstellung des Busverkehrs in Offenburg und Umgebung auf emissionsfreie Antriebe. Die Forscher der Hochschule Offenburg haben in Zusammenarbeit mit der Stadt Offenburg, dem Forschungs- und Entwicklungszentrum EIFER und dem Karlsruher Institut für Technologie bereits herausgefunden, dass Wasserstoffbusse für den Überlandverkehr geeignet wären. Jetzt geht es um Möglichkeiten der Kostenreduzierung, den Aufbau der notwendigen Infrastruktur und einen Praxistest.
IND-E
Mit dem geplanten Projekt IND-E wollen die Forscher der Hochschule Offenburg die Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Industrie voranbringen. Ein Baustein auf dem Weg zu diesem Ziel ist die Elektrolyse von Wasserstoff. Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren.
HydroFlow
Im Projekt „HydroFlow“ entwickelt die Hochschule Offenburg einen hochpräzisen, eichfähigen Massedurchflussmesser für Wasserstoff. Dieser soll beispielsweise die Menge des abgegebenen Wasserstoffs an Tankstellen anzeigen. Denn nur wenn diese im Rahmen der gesetzlichen Toleranz exakt ermittelt werden kann, ist ein Verkauf möglich.
Wasserstoff Aktivitäten am INEM
Am Institut für Nachhaltige Energietechnik und Mobilität (INEM) der Hochschule Esslingen werden umfangreiche Aktivitäten im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien insbesondere im Verkehrsbereich verfolgt und in die Lehre eingebracht.
Beispielsweise wird im Projekt HyLix-B ein 26-Tonner mit Brennstoffzellenantrieb aufgebaut und anschließend in der Region durch eine Spedition betrieben. Das Vorhaben wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert und zusammen mit regional ansässigen Unternehmen durchgeführt.
Im Rahmen des vom Bund geförderten Verbundprojekts H2 Rivers ist INEM zentral an mehreren Teilvorhaben beteiligt: So unterstützt das Institut die Konzeption und Förderantragstellung für ein Vorhaben zur Wasserstoffproduktion und -abgabe in Waiblingen, ebenso wie für ein verbundenes Projekt zum Betrieb von 9 Brennstoffzellenbussen im Rems-Murr-Kreis. Zudem treibt INEM zusammen mit Partnern die Herstellung, den Verkauf und den Einsatz zweier 4,6-Tonner mit Brennstoffzellenantrieb im Landkreis Esslingen voran.
Darüber hinaus verfolgt INEM weitere Hardware-Projekte im Bereich Brennstoffzellenfahrzeuge und Wasserstoffinfrastruktur. Wissenschaftlich untermauert wir dies durch Studien z.B. zum Betrieb von Nullemissionsbussen und –triebzügen in der Region.
Promotionsvorhaben:
Intersektorale Energieverknüpfung unter besonderer Berücksichtigung der Mobilität mittels Hochdruckelektrolyse
Im Fokus des Forschungsvorhabens steht die Entwicklung eines neuartigen Elektrolyseurs, um Wasserstoff und Sauerstoff unter Druck zu erzeugen. Bei der Elektrolyse handelt es sich um einen elektrochemischen Prozess, bei diesem Wasser durch die Zufuhr von Strom in seine Bestandteile gespalten wird.
Es handelt sich um externe Arbeit am EWS der Universität Ulm.
Demonstrator Virtuelles Kraftwerk Neckar-Alb
Das Virtuelle Kraftwerk Neckar-Alb unter der Leitung von Prof. Dr. Frank Truckenmüller ist ein Reallabor an der Hochschule Reutlingen, das als Testumgebung für die Entwicklung, Prüfung und Optimierung der zukünftigen Energiewelt dient. Auch die Wasserstofferzeugung und Brennstoffzellen können hier mit eingebunden werden.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Konsortium: Verschiedene Industriepartner; IHK; Universität Tübingen
Der „Demonstrator Virtuelles Kraftwerk Neckar-Alb“ ist ein reales Lehr-, Forschungs- und Entwicklungslabor. Das VK-Neckar-Alb ist gleichermaßen Demonstrations- und Testumgebung für die Entwicklung, Prüfung und Optimierung von Produkten der projektbeteiligten Industriepartner sowie eine Lern- und Forschungsplattform für die Studierenden sowie Professorinnen und Professoren am Reutlinger Energiezentrum.
Die Besonderheit dieses Projektes ist der Live-Betrieb: Auf dem Campus wurden bestehende Gebäude und Anlagen in diesem Demonstrator integriert und zusätzlich neue Anlagen installiert. Die Gebäude der Hochschule sind gleichzeitig Speicher und Verbraucher, deren Verbrauchsdaten erfasst und in den Prognoseberechnungen berücksichtigt werden. Die an der Hochschule in der Maschinenhalle integrierten Bestands-Maschinen, wie zum Beispiel das Blockheizkraftwerk (BHKW) oder die Wärmepumpe werden erfasst. Genauso wie ein neues BHKW, eine Adsorptionskältemaschine, ein PVT-System – das gleichzeitig Photovoltaikstrom und solare Wärme gewinnt, Wärme- und Stromspeicher, Ladesäulen für Elektro-Autos und E-Bikes. Dadurch ist in kürzester Zeit ein sogenanntes „MicroGrid“ entstanden.
Auch produzierende Unternehmen aus der Region sind als externe Teilnehmer an das Virtuelle Kraftwerk über eine digitale Vorrichtung – die „Steuerbox“ – angebunden. Deren Energieversorgung wird in der Leitwarte überwacht und bei Bedarf ein Optimierungsvorschlag an die Partner gesendet. Somit ergeben sich für diese „externen“ Teilnehmer konkrete Energie- und Ressourceneinsparungen sowie eine Verbesserung der CO2-Bilanz im eigenen Betrieb. Diese Unternehmen testen als Erste die neuesten Entwicklungen aus allen Bereichen für ihre Energieversorgung und profitieren dadurch, diese im eigenen System integrieren zu können.
Das VK-Neckar-Alb stellt somit eine geeignete Plattform dar, um stationäre sowie mobile Brennstoffzellen bzw. Elektrolyseure bedarfsabhängig in das Stromnetz einzubinden.
Projekt HyStarter – Wasserstoffregion Reutlingen
Der Landkreis Reutlingen ist eine von 9 Modellregionen, die im Rahmen des Projektes HyStarter vom BMVI gefördert werden. Im Kern geht es um die Entwicklung eines Wasserstoffkonzeptes für die Region und die Herausbildung eines Akteursnetzwerks sowie die Ausarbeitung von konkreten Projektideen, die in einem Folgeschritt umgesetzt werden sollen. In der Modellregion Reutlingen liegt der Fokus auf Anwendungen in der Industrie.
“Power-to-Gas: Keys to the Decarbonization of the European Electricity System”
Energiesystemsimulation zu Power-to-Gas als Langzeitspeicher im europäischen Energiesystem zur Untersuchung der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit. Durch die Betrachtung aller Sektoren und deren Querverbindungen sowie der möglichen Alternativverfahren werden die Bereiche identifiziert, in denen die Technologie am ehesten wirtschaftlich betrieben werden könnte.
Konsortium: Hochschule Reutlingen unter der Leitung von Prof. Dr. Clemens van Dinther,Karlsruer Institut für Technologie (Institut für industrielle Produktion), University of Pennsylvania (Wharton School)
Reallabor-Forschung zur Einführung von neuen Energietechnologien und Energieeffizienz und Energiemanagement in Unternehmen und Kommunen
Prof. Dr. Sabine Löbbe untersucht den Umgang mit Energie und Energieeffizienz in Unternehmen nicht nur aus technischer und ökonomischer Sicht, sondern beleuchtet auch sozialwissenschaftliche Aspekte. Bezüglich des Einsatzes von Wasserstoff im Schwerlast- und Wirtschaftsverkehr untersucht sie strategische, organisatorische und Verhaltens-bezogene Hürden und Erfolgsfaktoren, insbesondere von Industrie- und Logistik-Unternehmen.
Weiterführende Informationen:
Der Umgang mit Energie und Energieeffizienz vollzieht sich vor einem organisationalen und unternehmenskulturellen Hintergrund. Hemmnisse wie Treiber von neuen Energietechnologien und Energieeffizienz werden in unserer Forschung daher nicht alleine auf technische oder ökonomische Faktoren reduziert, sondern mit sozialwissenschaftlicher Expertise in anwendungsorientierter Forschung gemeinsam mit den Akteuren in Lösungsstrategien überführt (politische, ökonomische Anreize zur Verhaltensbeeinflussung, Geschäftsmodelle/-Ökosysteme). Die Forschungsfrage bzgl. Wasserstoff z.B. im Schwerlast- bzw. Wirtschaftsverkehr lautet damit: „welche strategischen, organisatorischen und Verhaltens-bezogenen Hürden und Erfolgsfaktoren unterstützen bzw. verhindern diese Nutzung aus Sicht der Akteure – allem voran die Industrie- und Logistik-Unternehmen?
„Untersuchungen von Blockheizkraftwerken zur effizienten Residuallastdeckung“
Am BHKW-Prüfstand der Hochschule Reutlingen können Blockheizkraftwerke, insbesondere auch wasserstoffbetriebene BHKW, unter der Leitung von Prof. Dr. Bernd Thomas im Zusammenspiel mit Wärmespeichern und den Wärmeabnehmern in der Objektversorgung detailliert untersucht werden.
Weiterführende Informationen:
Die BHKW-Prüfung ist in der Vergangenheit in verschiedenen Forschungsprojekten erfolgt, und dabei ist ein Algorithmus zum stromorientierten, netzdienlichen Betrieb von BHKW entwickelt und in einer Hardware-in-the-Loop-Umgebung am Prüfstand getestet worden. Mit dieser Umgebung kann der Einsatz von wasserstoffbetriebenen BHKW in gleicher Form untersucht werden, um das Potenzial dieser Technologie zur Residuallastdeckung herauszuarbeiten. Neben Brennstoffzellen-BHKW geht es dabei insbesondere um den Test von wasserstoffbetriebenen Motor-BHKW, wobei der Wasserstoff entweder per Leitung oder über einen Elektrolyseur unter Verwendung von Strom aus den PV-Anlagen der Hochschule bereitgestellt werden könnte.