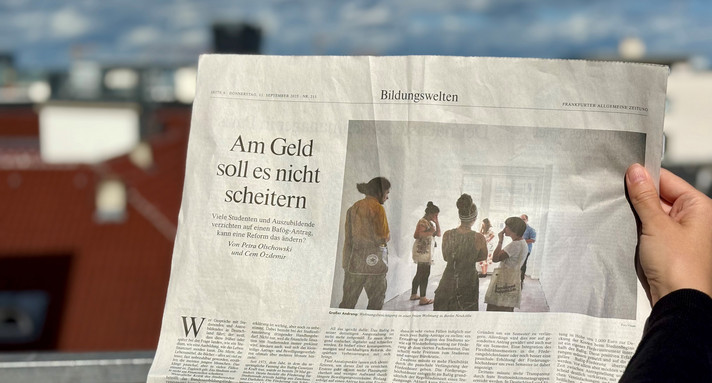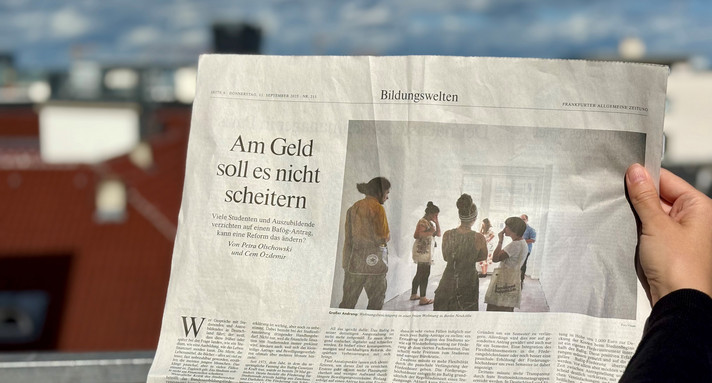Von Petra Olschowski und Cem Özdemir
Wer Gespräche mit Studierenden und Auszubildenden in Deutschland führt, der weiß, dass diese früher oder später bei der Frage landen, wie ein Studium, wie eine Ausbildung, wie das Leben finanziert werden kann. Die Miete, die Lebensmittel, die Bücher - alles sei viel zu teuer, fast unbezahlbar, geworden, erzählen die meisten jungen Menschen. Das klingt pauschal, aber in vielen Fällen stimmt es. Zugleich gilt: Ein Studium sollte nicht am Finanziellen scheitern.
Wesentliche Kritik der Studierenden betrifft das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz: das Bafög. Die meisten verzichteten darauf, so sagen sie, überhaupt einen Antrag zu stellen. Ihre Erzählungen decken sich mit den offiziellen Daten. Die Zahl der Bafög-Empfänger ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000 gefallen. Und die aktuelle Förderung ist zu gering, wenn man bedenkt, wie hoch die Mieten in Stuttgart, Heidelberg oder Tübingen sind. Dabei hatte das Bafög sich seit seiner Einführung vor mehr als fünfzig Jahren als ein wichtiger Eckpfeiler der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland etabliert. Es hat vielen jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, unabhängig von der finanziellen Lage ihrer Eltern ein Studium zu beginnen und erfolgreich abzuschließen.
Daher ist es Zeit für eine große Bafög-Novelle. Zuständig dafür ist die Bundesregierung. Aus Sicht eines Bundeslandes wie Baden-Württemberg begrüßen wir die geplante Erhöhung der Wohnkostenpauschale und die Dynamisierung der Freibeträge. Auch die erneute Anpassung des Grundbedarfs ist ein richtiger Schritt.
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde vereinbart, den Bafög-Bezug weiter zu vereinfachen, zu digitalisieren und zu beschleunigen. Diese Absichtserklärung ist wichtig, aber noch zu unbestimmt. Dabei besteht bei der Studienfinanzierung dringender Handlungsbedarf. Nicht nur, weil die finanzielle Situation von Studierenden immer prekärer wird, sondern auch, weil sich das kleinteilige Antrags- und Bewilligungsverfahren oftmals über mehrere Monate hinweg zieht.
Seit 1971, dem Jahr, in dem die ursprüngliche Fassung des Bafög-Gesetzes in Kraft trat, wurde es bereits 29 Mal geändert. Heute besteht die Förderung für Studierende jeweils hälftig aus Zuschuss und Darlehen. Die Förderung von Schülerinnen und Schülern wurde als Vollzuschuss beibehalten. Ziel war es, das Bafög durch gesetzliche Änderungen einzelfallgerechter zu machen. Dadurch stiegen aber die Anforderungen an die Nachweise zur Bewilligung von Ausbildungsförderung. Das gesamte Bewilligungsverfahren wurde umfangreicher und prüfintensiver, unübersichtlicher und dadurch unattraktiver.
Nur wenigen Antragstellenden gelingt es heute auf Anhieb, einen vollständigen Antrag einzureichen. Der Regelfall ist, dass notwendige Nachweise zu Einkommen und Vermögen der Eltern, zu Studienleistungen, Stipendien, Kranken- und Pflegeversicherung und Immatrikulation bei der Antragstellung fehlen und von den Bewilligungsstellen nachgefordert werden müssen. Das Verfahren wird für die Antragstellenden, aber auch die Mitarbeitenden in den Bafög-Ämtern zur bürokratischen Odyssee.
Auch das eigentliche Ziel des Bafög, die Chancengleichheit im Bildungswesen sicherzustellen, kann durch die wachsende Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Lebenshaltungskosten und den Bafög-Fördersätzen immer weniger erreicht werden. Was wir stattdessen bekommen: Studierende, die sich verschulden oder neben dem Vollzeitstudium noch Vollzeit arbeiten müssen.
All das spricht dafür: Das Bafög in seiner derzeitigen Ausgestaltung ist nicht mehr zeitgemäß. Es muss dringend einfacher, digitaler und schneller werden. Es bedarf einer konsequenten, mutigen und nachhaltigen Reform, die spürbare Verbesserungen mit sich bringt.
Fünf Ansatzpunkte lassen sich zur Erreichung dieses Ziels identifizieren:
1. Mehr Planungssicherheit und weniger Aufwand durch längere Bewilligungszeiträume
Bislang erfolgt auf einen Antrag hin eine Förderung in der Regel für einen Bewilligungszeitraum von zwölf Monaten. Danach muss für eine Weiterförderung stets ein erneuter Antrag gestellt werden. Wir schlagen vor, den Bewilligungszeitraum auf mindestens zwei Jahre zu verlängern. Im Bachelorstudium wären dann in sehr vielen Fällen lediglich nur noch zwei Bafög-Anträge zu stellen: ein Erstantrag zu Beginn des Studiums sowie ein Wiederholungsantrag zur Förderung ab dem vierten Fachsemester. Das schafft mehr Freiraum zum Studieren und weniger Bürokratie.
2. Mehr Flexibilität durch die pauschale Verlängerung der Förderdauer
Die Förderungshöchstdauer entspricht im Bafög grundsätzlich der Regelstudienzeit eines Studiengangs. Aktuell kann Förderung bestimmten Gründen (z.B. Krankheit, Gremienarbeit) über die Höchstdauer hinaus gewährt werden. Zum Wintersemester 2024/2025 wurde das sogenannte Flexibilitätssemester eingeführt. Dieses ermöglicht es Studierenden, den Förderzeitraum nach Ende der Regelstudienzeit ohne Angabe von Gründen um ein Semester zu verlängern. Allerdings wird dies nur auf gesonderten Antrag gewährt und auch nur für ein Semester. Eine Integration des Flexibilitätssemesters in die Förderungshöchstdauer oder noch besser eine pauschale Erhöhung der Förderungshöchstdauer um zwei Semester ist daher angezeigt.
3. Mehr Transparenz durch feste Bruttoeinkommensgruppen
In Deutschland sind Eltern grundsätzlich verpflichtet, ihren Kindern Unterhalt zu leisten, solange sich diese in Ausbildung befinden und ihren Lebensunterhalt nicht selbstständig bestreiten können. Erst wenn deren Einkommen teilweise oder gar nicht ausreicht, um diese Unterhaltspflicht zu decken, greift das Bafög. Deshalb sind für die Bafög-Berechnung die Einkommen von Eltern, Geschwistern und Ehe- bzw. Lebenspartnern der Auszubildenden maßgeblich. Dabei liegt aktuell der Feststellung des für das Bafög maßgeblichen Einkommens eine komplexe Berechnung zugrunde. In den meisten Fällen ist vorher allerdings nicht ersichtlich, ob ein Bafög-Anspruch besteht. Viele junge Leute gehen daher fälschlicherweise davon aus, keine Bafög-Förderung erhalten zu können.
Durch die Einführung fester Einkommensgruppen auf Basis des Bruttoeinkommens als Grundlage für die Ermittlung des Bafög-Anspruchs könnte diesem Problem begegnet werden. Dafür wäre ein grundlegendes Umdenken erforderlich – weg vom einzelfallbezogenen Einkommen hin zu einem System aus Einkommensgruppen.
4. Komplette Digitalisierung von der Antragstellung bis zur Bearbeitung
Mit der Einführung der Studienstarthilfe im Jahr 2024 wurde die ausschließliche Antragstellung auf digitalem Weg etabliert. Die Studienstarthilfe als pauschale Leistung in Höhe von 1.000 Euro zur Deckung der Kosten beim Studienbeginn ist ein eigenes Förderinstrument innerhalb des Bafög. Diese positiven Erfahrungen müssen genutzt und auf die reguläre Bafög-Förderung übertragen werden. Vor allem aber möchten wir die Zeit zwischen Antragstellung und Bescheid deutlich verkürzen, mit rechtlichen Vereinfachungen und einer einheitlichen digitalisierten Antragsbearbeitung. Oberste Prämisse muss sein, dass Studierende zügig ihre Zahlungen erhalten und nicht unverschuldet Monate auf ihren Bescheid warten müssen.
5. Regionale Realitäten widerspiegeln
Wir begrüßen die Anpassung des Grundbedarfs und die Erhöhung der Wohnkostenpauschale. Aber es braucht einen zuverlässigen Mechanismus für die Bedarfssätze und Freibeträge, um das Bafög automatisch an die steigenden Lebenshaltungskosten anzupassen. Die Wohnkostenpauschale muss daher unbedingt an die ortsüblichen Mieten angepasst werden.
Neben dem Bund und den Ländern haben sich auch die Deutschen Studierendenwerke und die Hochschulrektorenkonferenz bereit erklärt, jetzt gemeinsam zu handeln, um die Grundlage für eine neue erfolgreiche, gerechte und chancengleiche Bildungsrepublik zu schaffen. Wir stehen bereit, die Bafög-Reform voranzutreiben – und wir rufen alle Akteure auf, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Die Studierenden und die Auszubildenden haben es mehr als verdient. Wir müssen ihnen das Leben, das Studium und die Ausbildung erleichtern. Am Ende profitieren wir alle davon.